
Hallo zusammen!
Ich hab da vor einer Weile Jane Eyre gelesen und das hat einmal mehr bei mir einige Gedanken losgerüttelt, die ganz offensichtlich noch rausmüssen, bevor das Jahr zur Neige geht.
Das hier ist einer dieser langen Artikel bei mir, also macht’s euch ruhig bequem!
Jane Eyre ist ein Buch, über das ich vermutlich 20 Artikel schreiben könnte, aber nehmen wir mal nur einen Aspekt: Charlotte Brontës Roman wurde 1847 veröffentlicht, jedoch nicht unter ihrem richtigen Namen. ‘Schreibende Frauen’ war damals noch ein sehr … ähem … komplexes Thema, und der Roman erschien unter dem geschlechts-unspezifischen Pseudonym Currer Bell.
Natürlich weckte dieses Pseudonym dennoch die Neugier der Zeitgenossen. Und so kommt es, dass ein Buch, das heute gerade für seinen Ausdruck einer so spezifischen, starken Perspektive der Autorin Brontë gewertschätzt wird, rund um sein Erscheinen so wundersame Hot Takes produziert hat wie den folgenden, der 1848 im The Indicator zu lesen war:
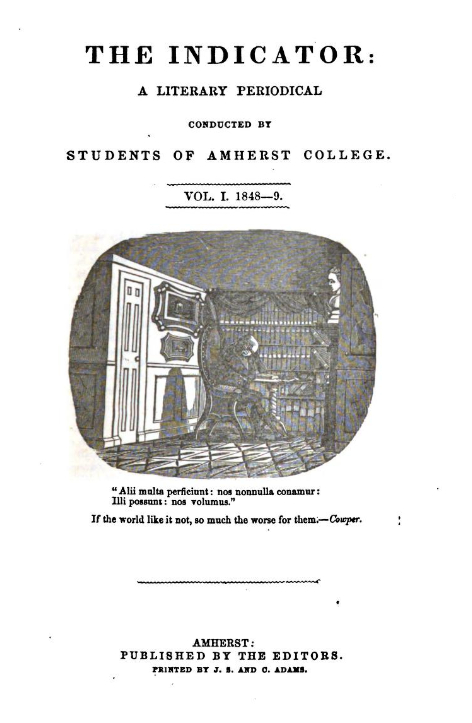
We doubt not it will soon cease to be a secret; but on one assertion we are willing to risk our critical reputation—and that is, that no woman wrote it. […] No woman in all the annals of feminine celebrity ever wrote such a style, terse yet eloquent, and filled with energy bordering sometimes almost on rudeness: no woman ever conceived such masculine characters as those portrayed here.
Dabei war es gar nicht der blanke Sexismus seiner Zeit, der mich in diesen Zeilen ansprang – na gut, nicht nur der –, sondern welch’ anderen Kontrast ich da zu heute sah.
Der Wert der Schöpfenden
Die Frage, welchen Einfluss und welchen Wert Kreativschaffende heute noch haben, ist eine, die erstaunlich oft diskutiert wird. Es ist immer mindestens implizit Thema, wenn es im Bereich Film darum geht, dass ja nur noch Fortsetzungen und Reboots erscheinen würden, oder eben Adaptionen (egal ob von Romanen oder Spielzeugfiguren). Es ist Thema, wenn gefragt wird, ob einzelne Regisseure (geschweige denn z.B. VFX Artists) bei einer so durchorganisierten Struktur wie Marvel überhaupt noch Einfluss einbringen können. Es ist Thema, wenn man sich fragt, wie Netflix es mit Filmen wie Red Notice schafft, unter absurden Kosten und viel involviertem Talent maximal seelenlose Berieselung zu erzeugen.
Und natürlich spielt es in jede Debatte rein, die sich mit generativer KI befasst.
Lasst mich an der Stelle zwei Sachen disclaimern: Nein, dies ist nicht der Artikel, in dem ich versuche das unendlich komplexe Thema KI an sich zu diskutieren, einzuordnen und zu bewerten. Nope, das ist eine Schlacht für einen anderen Tag.
Und ja, mir ist bewusst, dass das, was wir heute landläufig „KI“ nennen, nicht per se eine künstliche Intelligenz ist, aber irgendwie müssen wir das Kind ja nennen und ich bleibe jetzt heute mal bei genau dem: KI.
Dennoch, ein kurzer Exkurs ist relevant, denn wann immer jemand im Bezug auf Bilder, auf Texte, auf Musik fragt, ob wir denn überhaupt noch Illustratoren, Autoren, Musiker brauchen, dann ist das gar nicht so sehr eine Frage der Schöpfungshöhe; es ist die Frage, ob wir Schöpfungshöhe einen Wert beimessen.
Das ist keine triviale Frage und eine, auf die es womöglich je nach Nutzungs-Kontext mehrere unterschiedliche Antworten geben kann.
Eines aber ist technisch verankert: Generative KIs – und in einer annähernden Verlängerung all diese Produkte, die vor allem auf algorithmisch bestimmten Kundeninteressen und Marktanalysen basieren – werden immer bloße Remixe erzeugen. Dinge nehmen, die bewährt sind und funktionieren, und diese auf Arten rekombinieren, die hoffentlich fürs Publikum gefällig sind.
Insofern – und meine Entschuldigung an Autor Rawson Marshall Thurber – kann ich mir durchaus vorstellen, dass eine KI so etwas wie Red Notice generieren könnte. Das ist ja am Ende vor allem Dwayne-Johnson-Ryan-Reynolds-Bullshit-Bingo.
Aber so erschafft man halt kein Everything Everywhere All At Once in all seiner aufgeladenen Meta-Form, kein Last Night in Soho mit seiner tiefen Verbeugung vor und Liebe für die Stadt London in einer gelebten Epoche, und kein The Lighthouse in seinem Widerstreben, modernen Konventionen zu folgen.
Und eben auch – da sind wir wieder – kein Jane Eyre, einen Roman, der in Schreibstil und Perspektive so eine Wucht hatte, dass er quasi das Weltbild des Rezensenten beim Indicator erschüttern sollte.
Aber nun fragte ich mich: Wie sind wir eigentlich an diesen Punkt gekommen?
Das führt zur Frage, welche Rolle wir Künstlern in der (kommerziellen) Medienlandschaft 2023/24 zugesehen wollen.
Eine Frage des Anti-Intellektualismus
Ob die Person des Kunstschaffenden am Ende Bedeutung besitzen sollte in der Interpretation eines Kunstwerks, das ist eine Frage, wo sich zum Beispiel die Literaturwissenschaftler auch gar nicht mal einig sind. Das sprengt hier ebenfalls den Rahmen, aber um diese Frage wurde manch heißer Diskurs in den letzten Jahrzehnten gefochten.
Und natürlich ist das Internet ein Ort, an dem man zu jeder Meinung ein zynisches, nicht zu Ende gedachtes, aber Klicks generierendes Meme findet, wie eben auch:
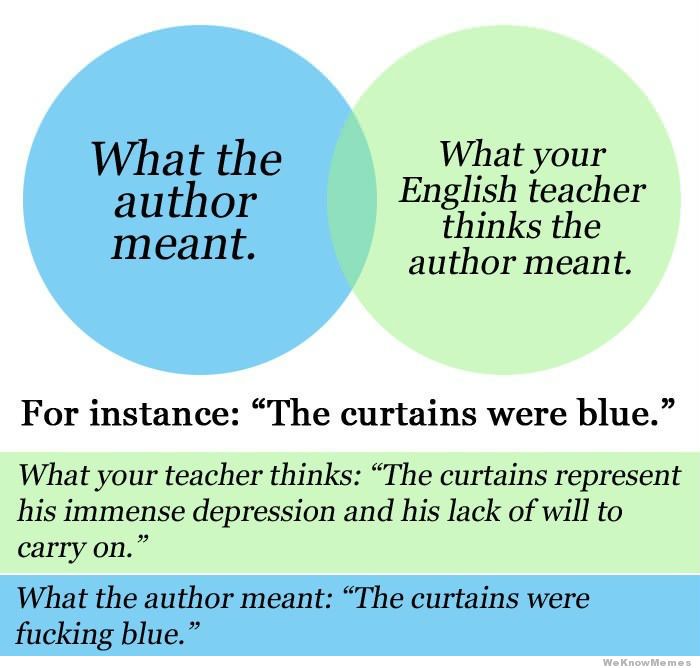
Wo das Meme hier beispielsweise vordergründig vor allem über die Interpretations-Erfahrungen in der Schulzeit unkt, steckt jedoch noch eine zweite Botschaft darin. Die Botschaft, was für ein Quatsch es doch ist, in den Texten eines Autors nach Bedeutung jenseits des reinen Wortlauts zu suchen. Und das ist ein Problem.
In meinen Augen ist es notwendig anzuerkennen, dass eine jede Perspektive, die ein Kunstwerk willentlich auf seine bloße Oberfläche reduziert – und das dem Kunstschaffenden ganz grundlegend jede Schöpfungsintention abspricht – letztlich vor allem Ausdruck einer schleichenden Form von Anti-Intellektualismus ist.
Mehr noch, Ausdruck eines inzwischen in Teilen normalisierten Anti-Intellektualismus.
Es ist die eine Frage, ob die Absicht der Kunstschaffenden Einfluss darauf haben sollte, wie wir ein Werk deuten. Die Intention aber – also die Perspektive der Schaffenden – als Anteil des Schöpfungsprozesses grundlegend bedeutungslos zu erklären, schafft eine Umgebung, in der die möglichen Bedeutungsebenen von Kunst von Anfang an reduziert werden auf nichts als den puren Text, bar allen Subtexts.
Dann ist man am Ende jeder Möglichkeit beraubt, nach der Bedeutung eines Werks zu forschen, es sei denn, man möchte wahlweise nur aufzeigen, welcher nächste Teil des Franchises sich hinter diesem Symbol und jenem Hinweis versteckt oder sich in offenkundigen Trivia ergehen.
Über die Defizite dieser Diskursform hab ich vor rund zwei Jahren schon geschimpft, aber immer mehr glaube ich, dass all das vor allem das Symptom einer Medienkonsumkultur ist, die – wie so vieles, was derzeit vorherrscht – niemals aus den Interessen der Konsumierenden geboren wurde.
Bestenfalls ist dies Ausdruck des Perma-Zynismus des klickgetriebenen Internets auf der Suche nach dem viralen Kick, aber in jedem Fall wird all das vor allem aus einem einzigen Streben befeuert, das sich in einem Wunschtraum, einem Luftschloss aus vier Worten zusammenfassen lässt:
Unendlicher Content, unendlich Geld
Hier ist eine ungeschönte Wahrheit: Für die modernen Medien-Plattformen geht es nur sekundär um die Qualität ihrer Inhalte. Es geht darum, Zuschauer dauerhaft dabei zu halten. Netflix und Disney wollen eure Augen auf dem Schirm, Instagram und TikTok wollen eure Daumen swipen sehen und Audible will nicht, dass ihr die Kopfhörer je absetzen müsst.
Sicherlich, Qualität ist eine Methode das zu erreichen – aber nicht die einzige. Moderner Medienkonsum gleicht mehr einer Slotmaschine. Wir ziehen am Hebel des einarmigen Banditen und kriegen ein Ergebnis, erfüllend genug damit wir mehr wollen und zugleich nicht so erfüllend, dass wir danach genug haben. Das kritisiere ich schon lange im Bezug auf soziale Medien, aber es ist zum Beispiel auch nicht anders bei den Streaming-Plattformen.
Zieh den Hebel, guck was rauskommt.
Warum sorgt Netflix denn mit automatisierten Programmvorschlägen basierend auf Nutzerdaten und mit individuellen, auf den Nutzer angepassten Thumbnails dafür, dass euch idealerweise direkt etwas auf der Startseite abholt, was ihr dann nicht ausschaltet. Warum ist es denn bei der App nun teils schon so, dass nicht mal mehr nur ein Trailer läuft, wenn ihr zu lange auf einem Film ruht, sondern der Film gleich beginnt? Damit ihr dran bleibt.
Alles ist ein Franchise, und wenn ihr nicht ‘vom Wagen fallen wollt’, heißt das natürlich auch, dass ihr am Ball bleiben müsst.
Jederzeit spüren wir dabei den Sog der Chance, die hinter dem nächsten Vorschlag steckt. Vielleicht, denken wir uns, ist das noch besser. Sicher haben wir gerade Spaß, so irgendwie; aber vielleicht könnten wir ja noch mehr oder noch leichter Spaß haben. Und überhaupt müssen wir dran bleiben, immerhin ist der Film gerade im Trend, man will ja mitreden. Ach, und von der aktuellen Staffel sind nur noch zwei Folgen übrig, die können wir ja auch noch eben …
Irgendwann ist der Film vorbei, die Serie gebinged, das Hörbuch ausgehört, und wir könnten nun reflektieren – aber andererseits gefiel Kunden, die unserer Meinung sind, auch dieses oder jenes andere Medium und an sich können wir uns das ja auch noch geben, oder?
Zieh den Hebel.
FOMO obsiegt.
Die Sache ist dann halt nur die: Qualitativ hochwertige Filme zu drehen oder Bücher zu schreiben, das kostet Zeit. Das kostet Aufwand. Das verlangt Inspiration. Das birgt in jedem Bruch mit irgendeiner Norm ein Risiko. Und das verlangt – auch bei den Kunstschaffenden – den Raum zur Reflexion.
Wenn aber „gut genug“ gut genug ist, die Leute bei der Stange zu halten, dann trennen sich hier die Interesse der Kunstschaffenden und der Plattformhalter, der Streaming-Dienste und der ganz großen Verlage.
Man kann natürlich sagen, dass wenn eben „gut genug“ doch gut genug ist, wenn die Leute es doch gucken, warum dann aufregen?
Ich denke Martin Scorcese hat das in der New York Times gut auf den Punkt gebracht:
And if you’re going to tell me that it’s simply a matter of supply and demand and giving the people what they want, I’m going to disagree. It’s a chicken-and-egg issue. If people are given only one kind of thing and endlessly sold only one kind of thing, of course they’re going to want more of that one kind of thing.

Alte und neue Sorgen
Dabei muss man fair sein und festhalten, dass Hiobsbotschaften über den Status der Medienindustrie vermutlich so alt sind wie eben jene Medienindustrie selbst. Dahingehend fand ich ganz spannend, was J. Michael Straczynski (genau, der Babylon-5-Mann) in seinem Buch The Complete Book of Script-Writing schreibt:[1]
These developments have led many media experts to announce that the film industry is just about to bite the dust in an economic western of its own making. […] Why, they ask, should an audience go out of its collective home at night, pay as much as five dollars or more per ticket […] when they can stay home and see a movie on cable, or on a video player?
Und mehr noch:
What further compounds the problem is the fact that studios are releasing versions of their films in some video format within an ever-shortening period after the film has been released to the theaters. It is expected that within the next few years, both versions of a motion picture may be released simultaneously— a prospect which does little to reassure theater owners.
Bemerkenswert: Das Zitat stammt aus der Ausgabe von 1982 – das sind 41 Jahre und im Endeffekt die gleichen Sorgen, die wir heute auch noch diskutieren. Ich denke aber, die Sachlage ist heute dennoch eine andere als eben damals. Und das nicht nur, weil Straczynski seinen Propheten-Status einen Absatz später wieder aufgeben muss. („[A] videodisc or videocassette player is not yet within the financial reach of every American consumer, and it is doubtful that it ever will be“ … ist weniger gut gealtert, sage ich mal.)
Die kulturelle Frage
KI und Algorithmen sind in diesem Bereich zweifelsohne eine Revolution. Und – ganz wichtig – zielgerichtet als Werkzeug benutzt, sind es starke Hilfsmittel, die auch Kunstschaffenden durchaus zuarbeiten können.
Wenn wir aber alles, was passiert, nur noch als Teil von Multimedia-Franchises begreifen wollen und wir all die Hilfsmittel, die sich uns bieten, einsetzen wollen, um gewissermaßen das optimale Opium fürs Volk bei minimalen Kosten zu erstellen, dann laufen wir Gefahr, etwas sehr kostbares zu verlieren. Wenn wir Bücher, Filme, Comics nicht mehr als Werke begreifen, in denen ein oder mehrere Kunstschaffende etwas zum Ausdruck bringen, sondern nur noch als content, als monetarisierbare Instanzen einer brand, einer IP, dann dürfen wir uns nicht beklagen, wenn sie auf kurz oder lang auch nur genau das liefern.
Und ich denke, wir beginnen gerade erste Anzeichen zu sehen, wie dieses Gebilde Risse bekommt. All die großen Unterhaltungsfirmen haben massenmediales Entertainment solange optimiert, bis sie zwischen Fortnite und dem MCU das perfekte Wesen gezüchtet haben – und doch kann man derzeit sehen, wie viele Blockbuster krachend scheitern, allen Optimierungen zum Trotz.
Das hat sicherlich viele Gründe und ich werde den Teufel tun zu behaupten, all diese Rätsel lösen zu können. Aber in einem Aspekt bin ich mir sicher: All die durchgestylte Massenunterhaltung kann vieles, aber sie kann schlicht nicht leisten, was Brontë getan hat – aus einer authentischen singulären, kontemporären Lebenserfahrung ein neues Narrativ schöpfen.
Medienkompetenz (mal wieder)
Wir können jetzt pauschal alles verdammen. Oder wir eignen uns die nötige Medienkompetenz (wieder) an und finden einen erwachsenen, unaufgeregten Umgang mit dem Thema.
Von Mikey Newman habe ich den Satz aufgelesen, dass Hollywood immer die falschen Lektionen lernt – und ich denke das ist generell wahr für die Unterhaltungsindustrie.
Denn ja: Wenn wir geradezu systematisch den Wert der Schöpfenden aus der Rechnung entfernen, dann bleibt am Ende in der Betrachtung nur die Schöpfung als bloßes Artefakt zurück. Damit verliert man aber einen Aspekt aus den Augen, der meiner Meinung nach gleich in welcher Medienform immer eine entscheidende Rolle spielt.
Dann hat man ein Logikgerüst, innerhalb dessen aus dem Erfolg von Barbie nicht abgeleitet werden kann, dass man mehr engagierten Kunstschaffenden die notwendigen Produktionsmittel geben sollte, ihre Geschichten zu erzählen. Dann diktiert die Logik zwangsläufig, dass wir stattdessen JJ Abrams’ Hot Wheels bekommen.
Aber auch für uns, als Publikum, stellt sich anhand dessen eine kulturelle Frage – welche Medien wollen wir konsumieren?
Ist das tiefe Labyrinth aus verschachtelten Franchises wirklich das, was wir wollen? Oder ist da der Wunsch nach mehr? Wollen wir Medien, die etwas in uns bewegen und uns neue Gedanken ins Hirn bringen, oder reicht uns stopfender Fast Food? Ich mag Fast Food, genauso wie ich Superhelden-Filme und Star Wars, Fast & Furious und Trashfilme mag.
Aber das kann doch nicht alles sein.
Also: Wollen wir die womöglich etwas ungewohnte, aber packende Erzählung von jemandem, der oder die etwas zu erzählen hat? Oder die sichere Bank des „Gut genug“ aus dem nächstbesten Franchise, dessen letzte Inkarnation ja auch passabel war und womit man die Zeit bis zum Tod ein wenig vertrödeln kann?
Ich nehme ersteres. Und hörbar machen können wir unsere Wahl letztlich nur durch unser (Kauf- und Konsum-)Verhalten, und indem wir darüber reden.
Und darum rede ich hier darüber.
Viele Grüße,
Thomas
Alle drei zitierten Straczynski-Textstellen entstammen aus: Straczynski, J. Michael: The Complete Book on Script-Writing. Writer’s Digest Books, Cincinnati 1982. Seite 193. ↩︎






 Wen hingegen meine berufliche Arbeit als Verlagsleiter und leitender Layouter für Ulisses Spiele interessiert, findet
Wen hingegen meine berufliche Arbeit als Verlagsleiter und leitender Layouter für Ulisses Spiele interessiert, findet